Die Vorlesungen von Walter Fanta aus den Jahren 2022 bis 2025 werden hier ausführlich festgehalten. Der erfahrene Literaturwissenschaftler arbeitet zu wichtigen Themen der Moderne. Dabei geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch darum, wie die Themen erklärt werden, damit mehr Menschen sie verstehen können. So wird das Manuskript der fünf Wiener Vorlesungen von Walter Fanta erst am Ende zu einem Buch. Indem durch Wiederholung – auch an anderen Orten – Schritt für Schritt aus dem Manuskript ein Skript und schließlich ein Lehrbuch entsteht. Dieser Prozess findet im Austausch mit dem Publikum statt, das ist das Hauptziel des Projekts.
Die Vorlesungen von Walter Fanta
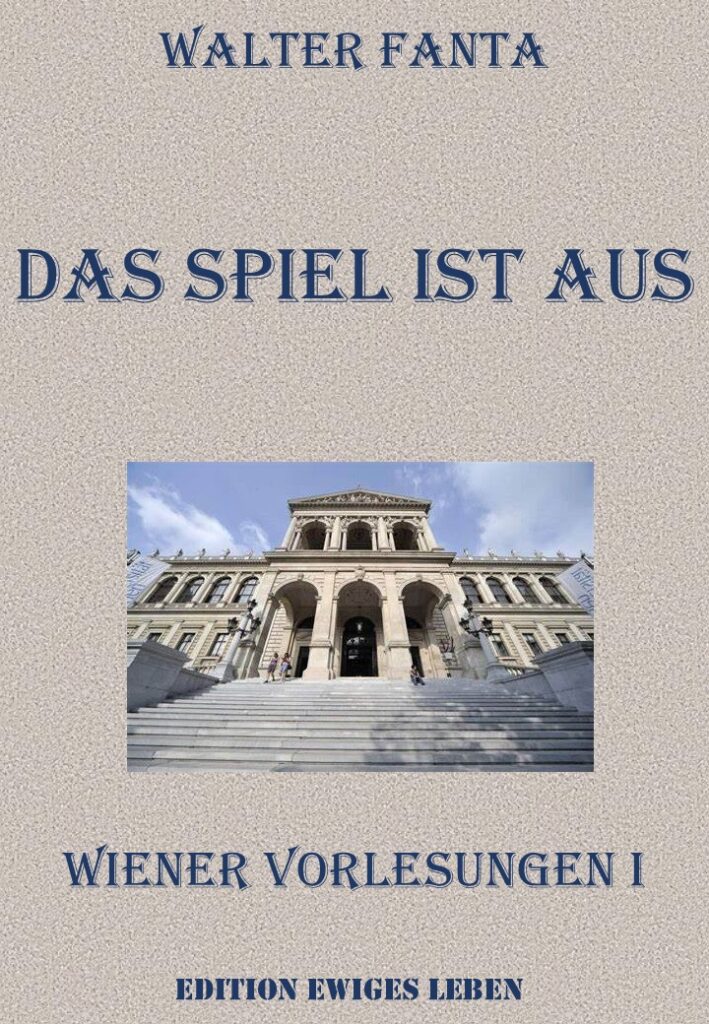
DAS SPIEL iST aUS
Was sind Romane? Romane sind Textspiele, bei denen Autorinnen und Autoren Figuren in ihren Geschichten steuern. Sie sind ein Spiel mit vielen möglichen und unmöglichen Lösungen. Verschiedene Lesarten führen zu Streit. Mit den Spielkategorien des französischen Soziologen Roger Caillois – Agon (Wettkampf), Alea (Zufall), Mimikry (Verkleidung), Ilinx (Rausch) – werden die Handlungsenden untersucht. Eine Auswahl bekannter deutschsprachiger Romane des 20. Jahrhunderts dient als Beispiel für verschiedene mögliche Enden. Die Enden der Bücher werden mit denen der Verfilmungen verglichen und ihre Logik hinterfragt. Muss das Vorlesungsskript neu geschrieben werden? Hätten die Romane nicht ganz anders enden können?
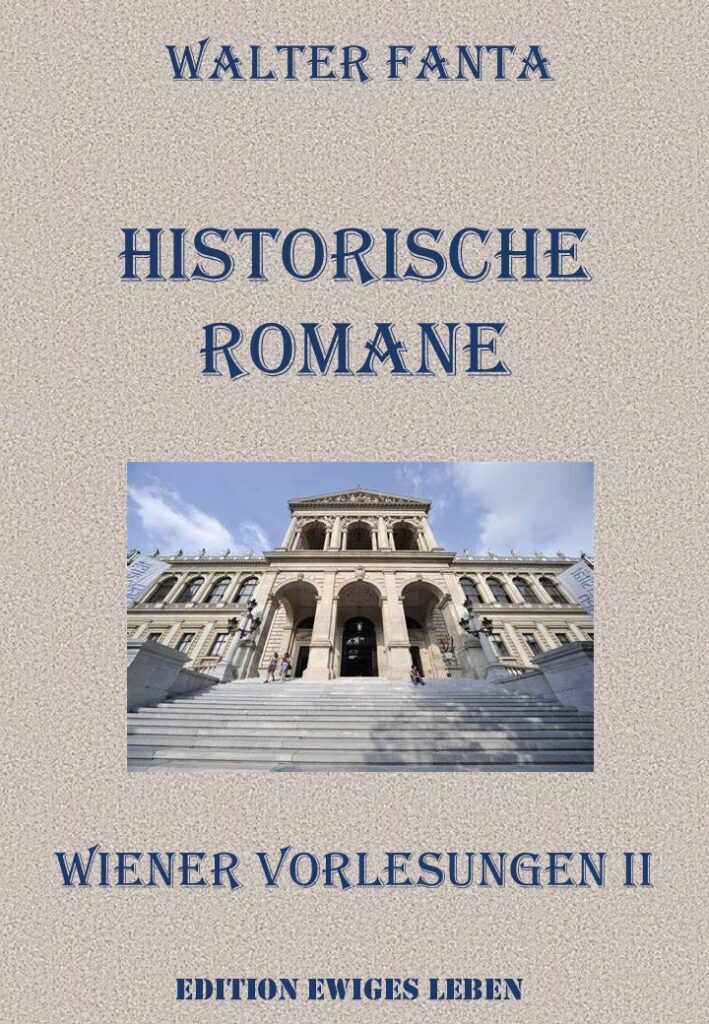
HISTORISCHE ROMANE
Sind das wir? Sind wir wirklich so? Die Vorlesung über historische Romane im 19. und 20. Jahrhundert will vor allem das Verständnis kollektiver Identität in den deutschsprachigen Gesellschaften vertiefen. Dabei spielt die Literatur eine zentrale Rolle bei deren Entstehung. Geschichte und Literatur scheinen dabei fast zu verschmelzen, wobei Geschichte mit dem kollektiven kulturellen Gedächtnis gleichgesetzt wird. Es werden verschiedene Wege untersucht, wie der Roman Geschichte vermittelt – Friedrich Nietzsche folgend als Nachahmung, Rechtfertigung und Kritik. Am Ende stehen wir an einem Punkt, an dem vor allem die Kritik zählt. Ist das gut so?
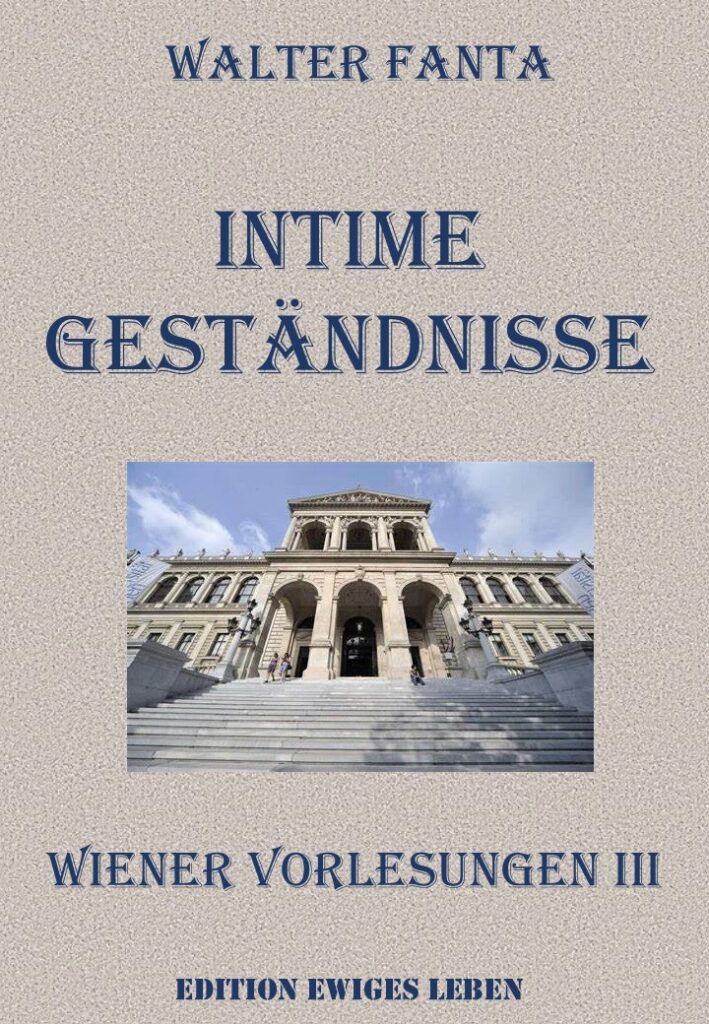
INTIME GESTÄNDNISSE
Wer bin ich? Im Mittelpunkt steht das Ich – das autobiografische Ich. Es geht um das Ich in der Literatur, das Schreiben über das eigene Leben, die dokumentarische Selbstbiografie und die autobiografische Fiktion. Die Texte stammen hauptsächlich von Frauen aus der deutschsprachigen und europäischen Literatur seit der Aufklärung. Theoretisch stützen wir uns auf die Konzepte des französischen Literaturwissenschaftlers Philippe Lejeune und auf drei Autor-Leser-Pakte sowie drei biografische Textarten: den Referenz-Pakt (Biografie), den autobiografischen Pakt (Autobiografie) und den Fiktionspakt (Autofiktion). Ziel der Vorlesung ist es, ein tiefes Verständnis zu vermitteln, das die Selbstreflexion der Lesenden fördert. Am besten verstehen wir diese Texte, wenn wir selbst zu Schreibenden werden.
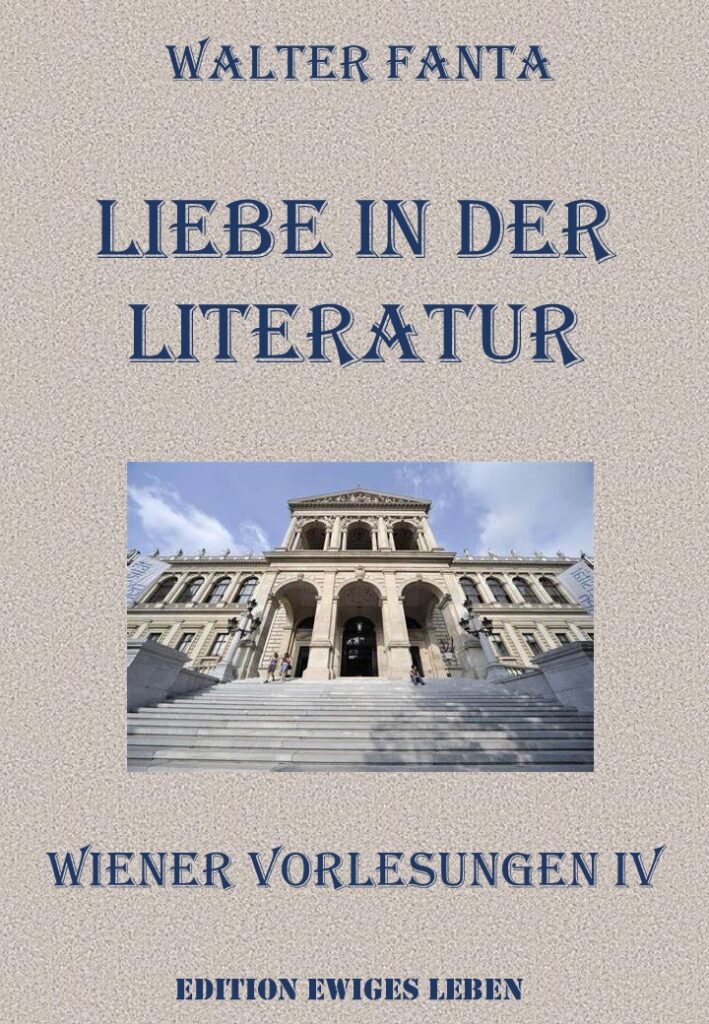
LIEBE IN DER LITERATUR
Was ist Liebe? Literarische Texte zeigen, wie sich der Begriff der Liebe im Laufe der Zeit verändert hat und wie er das Verhalten in der Gesellschaft beeinflusst. Diese Lektüre nutzt die Theorien des deutschen Soziologen Niklas Luhmann, um zu verfolgen, wie das romantische Ehe-Liebe-Konzept in der Literatur von 1774 bis 1942 entstanden und zerfallen ist. Werke aus dem deutschsprachigen Raum – von Goethe bis Musil – werden mit den damaligen und heutigen philosophischen, soziologischen, kulturellen, psychologischen und psychoanalytischen Ideen über Liebe verglichen. Besonders auffällig ist, dass vor allem männliche Autoren das bürgerlich-patriarchale Liebesmodell hinterfragten und aufbrachen. Welche Auswirkungen könnte die heutige strenge Cancel Culture auf diese Diskussion haben?
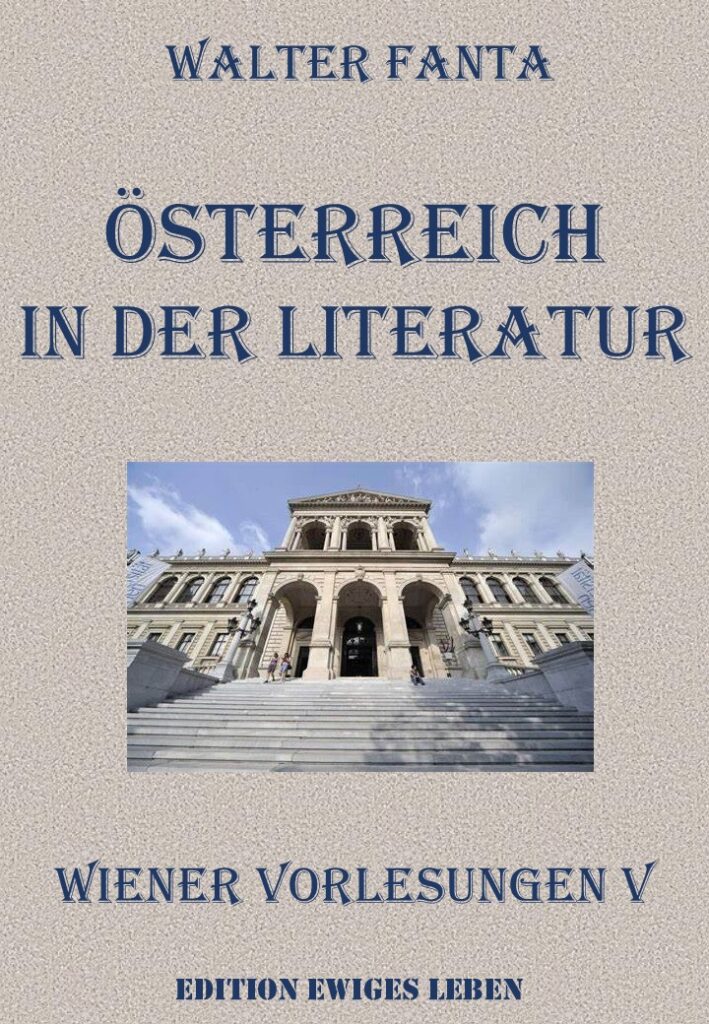
ÖSTERREICH IN DER LITERATUR
Österreich wird oft als literarisches Konstrukt gesehen, seine Identität entsteht durch kulturelle Erzählungen – diese These wird diskutiert. Mit dem kulturtheoretischen Modell des kollektiven Gedächtnisses werden die Prozesse der Nationenbildung Österreichs in verschiedenen historischen Phasen von Joseph II. bis zur EU-Zeit untersucht. Die literarische Form spielt dabei eine wichtige Rolle und prägt den Diskurs über Österreich. Dieser Diskurs lässt sich in sieben Phasen einteilen, in denen politische Ordnungen mit literarischen Epochen und Strömungen verbunden sind. Zeigt der literarische Diskurs über Österreich, dass die Nation nur eine Illusion ist?
Die Vorlesungen von Walter Fanta im Rahmen seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit:
https://www.walterfanta.at/start/forschung-lehre/
