Die Vorlesungstätigkeit von Walter Fanta seit 2022 wird hier dokumentiert. Nicht nur den Themen, die den habilitierten Dozenten für Neuere Deutsche Literatur beschäftigt haben, sondern auch der Art der Auseinandersetzung soll eine breitere Öffentlichkeit verschafft werden. Fünf Wiener Vorlesungen in Buchform gebracht stehen erst am Ende des Weges. Das Manuskript durch mehrfache Wiederholung – auch an anderen anderen akademischen Stätten – Schritt für Schritt weiter zu entwickeln, unter Einbeziehung des Diskurses mit dem Auditorium, das ist das Ziel.
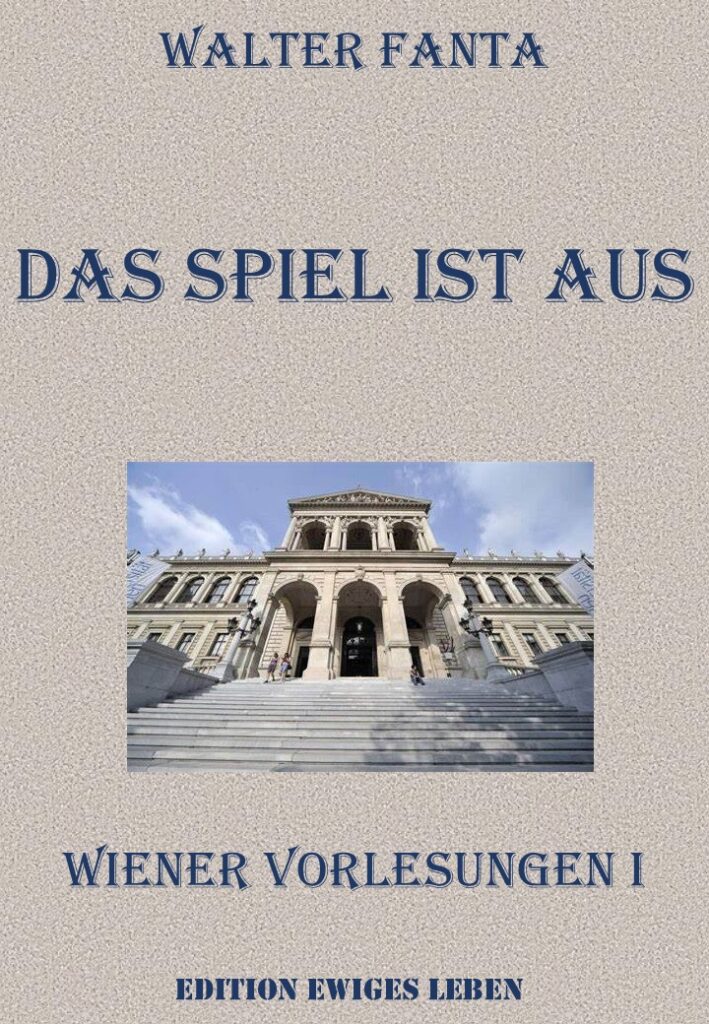
Was sind Romane? Es sind Textspiele, komplexe Spielanlagen von Autorinnen und Autoren mit Spielfiguren in ihren Texten. Schreibspiel mit einer Vielzahl möglicher und unmöglicher Lösungen. Streitspiele unterschiedlicher Lektüren. Ausgerüstet mit den Kategorien der Spieltheorie des französischen Soziologen und Ethnologen Roger Caillois – Agon (Wettkampf), Alea (Schicksal), Mimikry (Maskierung), Ilinx (Rausch) – werden Erzählausgänge studiert. Eine Auswahl aus der kanonisierten deutschsprachigen Romanliteratur des 20. Jahrhunderts bildet das exemplarische Anschauungsmaterial für die Untersuchung multipler Ausgänge. Die Textschlüsse werden mit den Enden der Verfilmungen verglichen und ihre Folgerichtigkeit in Frage gestellt. Muss das Vorlesungsmanuskript nicht umgeschrieben werden? Hätten die Romane nicht ganz anders ausgehen können?
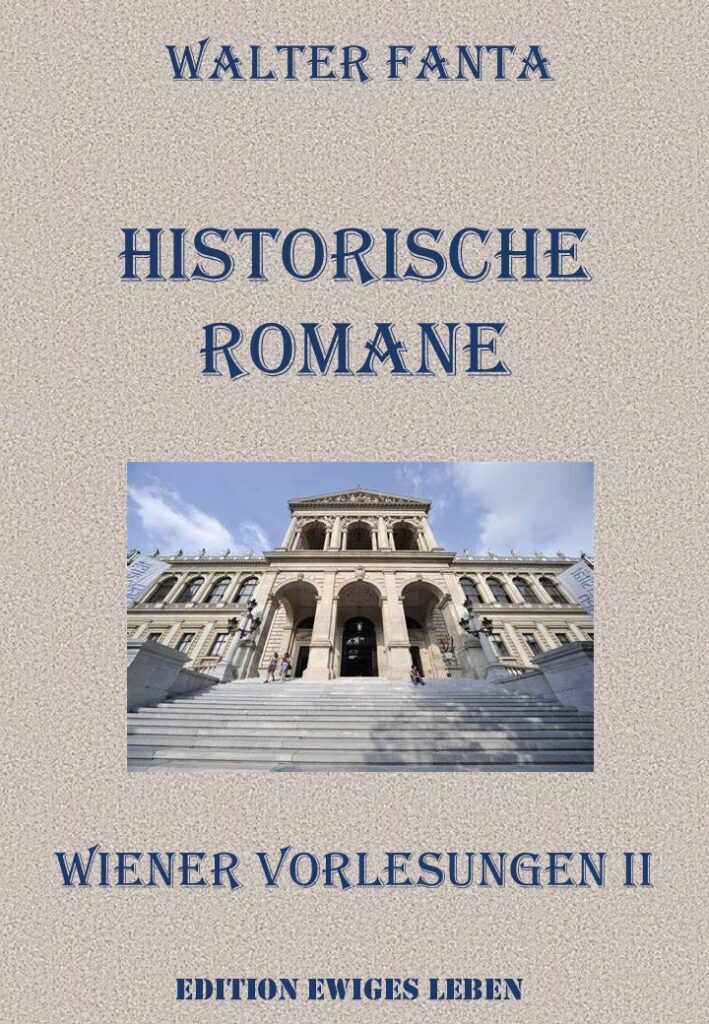
Sind das wir? Sind wir wirklich so? Die Vorlesung über historische Romane im 19. und 20. Jahrhundert möchte vor allem zum Verständnis von kollektiver Identität in den deutschsprachigen Gesellschaften beitragen. Bei deren Ausbildung ist die Rolle der Literatur nicht zu übersehen. Fast verschmilzt der Begriff der Geschichte dem der Literatur. Wobei die Geschichte mit dem kollektiven kulturellen Gedächtnis identifiziert wird. Es werden die Möglichkeiten erörtert, wie der Roman Geschichte vermittelt, nämlich Friedrich Nietzsche folgend als Nachahmung, als Rechtfertigung und als Kritik. Am Ende sind wir an einem Punkt angelangt, an dem nur mehr die Kritik zu zählen scheint. Gut so?
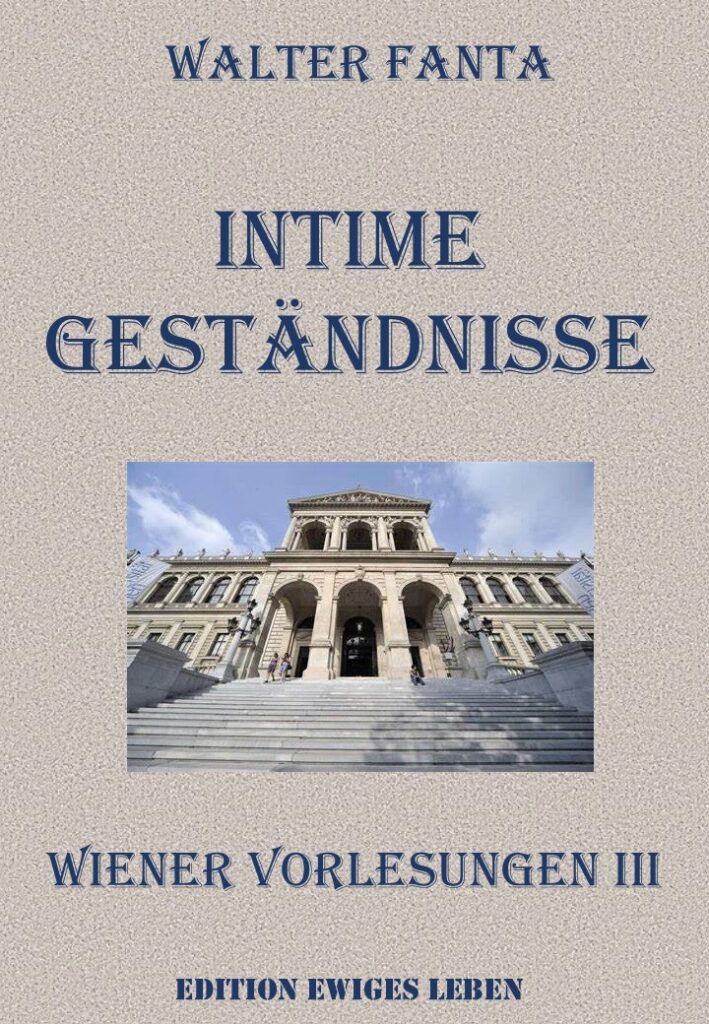
Wer bin ICH? Im Fokus steht das Ich, das autobiographische Ich. Das Ich in der Literatur, das Schreiben über sich selbst, die dokumentarische Selbstbiographie und die autobiographische Fiktion. Die Ausgangstexte stammen aus der deutschsprachigen und der europäischen Literatur seit der Aufklärung, mehrheitlich von Frauen verfasst. Den theoretischen Hintergrund bilden Kategorien des französischen Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune, drei Autor-Leser-Pakte und drei biographische Textsorten: der Referenz-Pakt (Biographie), der autobiographische Pakt (Autobiographie) und der Fiktionspakt (Autofiktion). Die Vorlesung vermittelt ein Verständnis mit dem letzten Ziel, zur Selbstbetroffenheit der Lesenden zu gelangen. Lesen können wir diese Texte am besten, indem wir selbst zu Schreibenden werden.
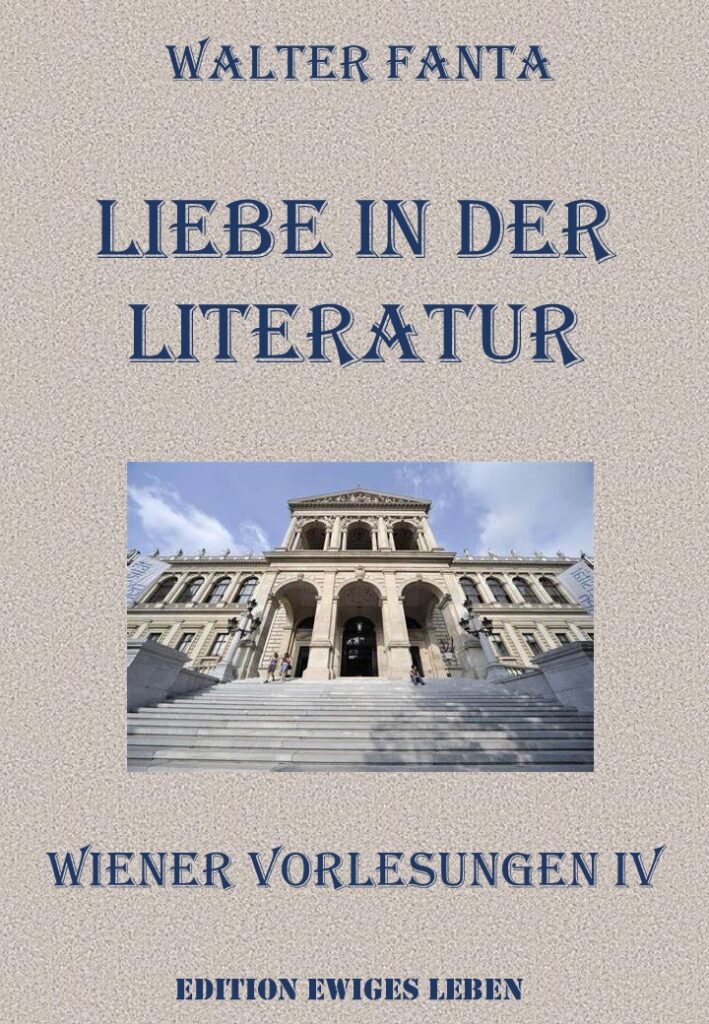
Was ist Liebe? Aus den literarischen Texten lässt sich der historische Charakter des Phänomens Liebe herauslesen; sie haben Verhaltensmuster konstituiert. Auf den Spuren des deutschen Soziologen Niklas Luhmann folgt die Lektüre Schritt für Schritt der Konstruktion und Dekonstruktion des romantischen Ehe-Liebe-Dispositivs in der Literatur der Epochen von 1774 bis 1942. Konfrontiert werden die Texte aus dem Kanon der deutschsprachigen Literatur von Goethe bis Musil mit zeitgenössischen Regelsystemen und damaligen wie aktuellen philosophischen, soziologischen, kulturtheoretischen, psychologischen, psychoanalytischen Konzeptualisierungen von Liebe. Es fällt auf, dass fast durchwegs männliche Autoren das bürgerlich-patriarchale Liebes-Dispositiv dekonstruiert haben. Was kann die gnadenlose aktuelle Cancel-Culture dem anhaben?
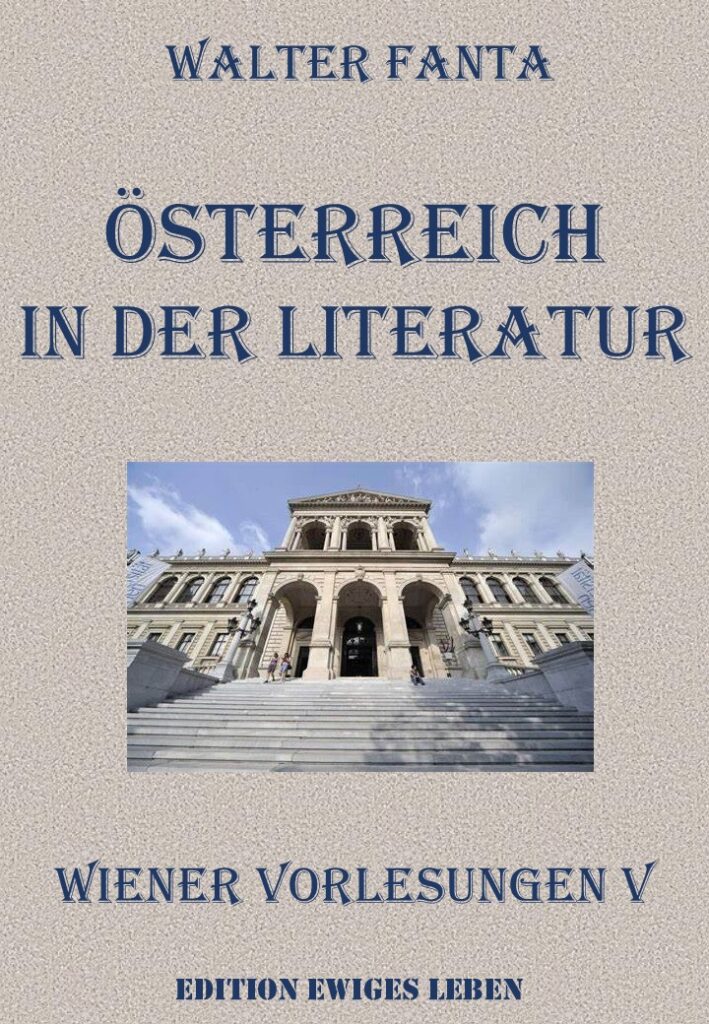
Österreich sei herbeigeschrieben worden, die österreichische Identität ein Konstrukt mehr oder weniger der Literatur – diese These steht zur Diskussion. Mit Hilfe des kulturtheoretischen Modells des kollektiven Gedächtnisses werden die Mechanismen der Konstruktion von Österreich als Nation in den unterschiedlichen historischen Abschnitten der staatlichen Entwicklung von Joseph II. bis in die EU-Gegenwart offengelegt. Eine auffallende Besonderheit zeigt sich in der bestimmenden Rolle der literarischen Form im Österreich-Diskurs. Er lässt sich in Abfolge von sieben Stadien als Kombination von politischen Ordnungen mit Epochen bzw. Strömungen innerhalb der Literaturgeschichte synchronisiert behandeln. Entlarvt der Österreich-Diskurs in der Literatur die österreichische Nation nicht als Schwindel?
